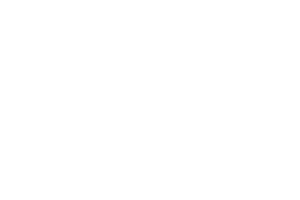Kleine Geschenke für Kinder unter 5 Euro
Kleine Spielzeuge sind beliebte Mitbringsel, sei es, dass man ein Gastgeschenk für ein Kind braucht oder allen Kindern auf der Geburtstagsparty noch ein kleines Geschenk mitgeben möchte. Wir haben für dich Spielsachen unter 5 Euro gesammelt, die Jungs und Mädchen viel Freude bereiten und ein Lächeln in alle Kindergesichter zaubern.
Kleine Spielzeuge und tolle Kindergeschenke bis 5 Euro
Diese Situation kennen viele: Der nächste Verwandtenbesuch steht an und du hast fast alle Gastgeschenke besorgt. Nun brauchst du aber auch noch ein Mitbringsel für das Kind der Familie. Statt Süßigkeiten möchtest du dem Kind ein Spielzeug schenken, das nicht mehr als 5 Euro kostet. Es soll ihm Freude bereitet und nicht beim ersten Spielen zu Bruch gehen. Doch was kannst du für diesen kleinen Geldbetrag kaufen? Unsere Antwort lautet: Eine ganze Menge, und teilweise brauchst du nicht mehr als 3 Euro auszugeben. Wir haben uns auf die Suche nach kleinen Kindergeschenken gemacht und viele tolle Spielsachen unter 5 Euro gefunden.
Kleine Mitgebsel bis 5 Euro zum Kindergeburtstag
Eine Geburtstagsfeier soll für ein Kind und seine kleinen Geburtstagsgäste ein unvergessliches Erlebnis werden. Dazu müssen die Eltern die Party vorbereiten: Das Geburtstagskind wünscht sich seinen Lieblingskuchen, den die Mutter noch backen muss. Die Eltern sollten auch einen Plan für mögliche Kindergeburtstagsspiele machen und die dafür benötigten Utensilien besorgen. Und zum Abschluss kann man den Geburtstagsgästen kleine Mitgebsel mit auf den Weg nach Hause geben. Dazu eigenen sich Spielsachen, die nicht mehr als 5 Euro kosten. Schließlich ist es für viele Eltern wichtig, einen bestimmten finanziellen Rahmen einzuhalten, aber dennoch eine ganz besondere Geburtstagsfeier für die Kinder auszurichten.
Kleine Mitbringsel für Jungs und Mädchen
Malbücher: Sinnvolle Mitbringsel unter 3 Euro
Von fantasievollen Vorlagen zum Ausmalen können kleine Kinder nie genug bekommen. Schnell sind alle Tiere und Gegenstände in den Büchern ausgemalt und es muss Nachschub her. Schöne Malbücher mit Tieren, Prinzessinnen und Baustellenfahrzeugen gibt es bereits für unter 3 Euro. Auch im Grundschulalter gehört das Ausmalen der Vorlagen zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen.
Rätselbücher: Pädagogisch wertvolle Geschenke für Kinder im Grundschulalter
Für Grundschüler sind Rätselbücher ein sinnvolles Geschenk. Um die Rätsel zu lösen, müssen die Kinder nachdenken, ausprobieren und manchmal ein wenig rechnen. Durch den spielerischen Aspekt macht ihnen das Rätseln großen Spaß und motiviert zum Weitermachen, bis sie endlich die richtige Lösung gefunden haben. Rätselbücher fördern die geistigen Fähigkeiten auf spielerische Art und Weise und gehören zu den beliebtesten Mitbringseln, wenn man Kindern eine Kleinigkeit schenken möchte.
Kleine Outdoor-Geschenke für Spaß und Action an der frischen Luft
Die meisten Kinder sind von Spielsachen angetan, die man fliegen lassen kann. Wurf- und Flugspielzeuge gibt es schon für wenig Geld zu kaufen und animiert Kinder dazu, an der frischen Luft zu spielen. Seifenblasen, die man in die Luft pusten kann, üben schon auf 2-Jährige eine besondere Faszination aus. Ein Pustefix erhält man bereits für unter 3 Euro und ist vor allem für Kindergartenkinder ein tolles Mitbringsel oder ein Geschenk, dass man Jungs und Mädchen nach einer Geburtstagsparty mitgeben kann. Als kleine Outdoor-Geschenke für 3-Jährige, 4-Jährige und 6-Jährige eigenen sich Styropor-Flugzeuge, die sich sehr einfach zusammenstecken lassen und nach dem Werfen lange durch die Luft gleiten.
- Kleine Geschenke für Kinder unter 10 Euro
- Geschenke für 1-jährige Jungs
- Geschenke für 2-jährige Jungs
- Geschenke für 3-jährige Jungs
- Geschenke für 4-jährige Jungs
- Geschenke für 5-jährige Jungs
- Geschenke für 6-jährige Jungs
- Geschenke für 1-jährige Mädchen
- Geschenke für 2-jährige Mädchen
- Geschenke für 3-jährige Mädchen
- Geschenke für 4-jährige Mädchen
- Geschenke für 5-jährige Mädchen
- Geschenke für 6-jährige Mädchen
- Geschenke für 1-jährige Kinder
- Geschenke für 2-jährige Kinder
- Geschenke für 3-jährige Kinder
- Geschenke für 4-jährige Kinder
- Geschenke für 5-jährige Kinder
- Geschenke für 6-jährige Kinder
- Geschenke für kleine Handwerker
- Balkonspielzeug: 5 tolle Balkon-Spielsachen für Kinder
- Die 34 beliebtesten Spielzeuge für 2-jährige Kinder
- Die 41 beliebtesten Spielzeuge für 3-jährige Kinder
- Gartenspielzeug: 50 tolle Outdoor-Spielzeuge für Kinder
- Die 10 beliebtesten Spielzeugpistolen für Kinder
- Das beste Bosch Kinderwerkzeug für kleine Handwerker